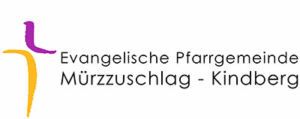Historie der Heilandskirche Mürzzuschlag
Die Heilandskirche ist ein neugotischer Backsteinbau mit steinernen Gliederungs – und Zierelementen, der im Jahre 1900 in nur fünf Monaten Bauzeit nach den Plänen des Wiener Architekten Karl Steinhofer errichtet worden ist. Die Kirche thront auf einem seit alters her „Ölberg“ genannten Hügel im Süden Mürzzuschlags und beherrscht das Stadtbild.
Der mehrgeschossige Turm mit reichhaltiger Gliederung und einem verzierten Helmdach wendet sich nach Norden. Über einem von einem Spitzbogen gerahmten Portal, in dessen Tympanon das Lamm Gottes zwischen Alpha und Omega ruht, thront in einer Nische der segnende Auferstandene mit wallendem Haar und Vollbart. Blickt man vom Kircheneingang nach Norden, so kann man ein zu allen Jahreszeiten grandioses Panorama genießen. Zu Füßen des Hügels erstreckt sich die Stadt, dem Mürztal aufwärts folgend wird der Blick zur grandiosen Kulisse der Schneealm gelenkt. Nach Westen schweift das Auge weit das Tal hinab, beim Blick nach Osten erkennt man die bewaldeten Hänge des Semmerings.
An den Turm schließt sich das einschiffige Langhaus an, das von einem Querschiff durchschnitten wird. Ein polygonaler Chor schließt die Kirche nach Süden ab. Die wenig konturierten Stirnseiten des Querschiffes werden durch hohe dreibahnige Maßwerkfenster, deren Abschluss reliefierte Brustbilder von Martin Luther und Philipp Melanchton bilden, aufgelockert.
Nach Durchschreiten des Portals gelangt man in eine kleine Vorhalle, von der aus der Turm zugänglich ist. Zum Langhaus ist sie durch ein schmiedeeisernes Gitter getrennt. Das Kircheninnere ist ein lichtdurchfluteter Raum, dessen Decke durch ein weitgespanntes Kreuzrippengewölbe, dessen Rippen auf kleinen Konsolen über flachen korinthischen Pilastern ansetzen, in zwei Joche gegliedert ist. Es folgt eine breite Vierung, die durch einen schmalen Triumphbogen mit der Aufschrift „ Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden“ vom flachen Chorraum abgeschlossen ist und der seitlich schmale Querschiffsjoche mit Spitztonnen angelagert sind. So entsteht im Widerspruch zur gotischen Form des Langhauses der Eindruck eines Zentralraumes. Die Glasfenster sind wieder stärker an historischen Vorbildern orientiert. Im Querschiff sieht man über vegetabilen Bahnen Medaillons, die Christus als Sämann und Johannes den Täufer zeigen. Den Chor zieren Glasgemälde, auf denen Petrus und Paulus in gotischen Architekturnischen abgebildet sind und auf Bibelstellen verwiesen wird.
Im Chor findet sich über Marmorstufen ein Tischaltar, dessen Platte auf einer maßwerkverzierten Rückwand und Säulen ruht. Der Altar trägt ein großes Kruzifix, dessen dunkles Kreuz mit einem weißen Korpus kontrastiert. Auf der linken Seite steht im Chor ein Taufstein, rechts hängt eine grau gestrichene hölzerne Kanzel mit farbig eingefassten Evangelistenreliefs.
Im reizvollen Kontrast zur hell gefärbelten Kirche steht das dunkle Holz der neugotischen Bänke und der Orgelempore mit kassettierter und maßwerkverzierter Brüstung.
Im linken Querschiff befindet sich ein Ölgemälde der „Heiligen Familie“, das Emil Böhm nach einem Bild seines Lehrers Franz Defregger unter teilweiser Beteiligung des Meisters geschaffen hat. Das für eine evangelische Kirche ungewohnte Marienbildnis wurde auf Wunsch Peter Roseggers, der sich sehr für die Errichtung der Kirche einsetzte, angebracht.
Text verfasst von Dieter Röschel